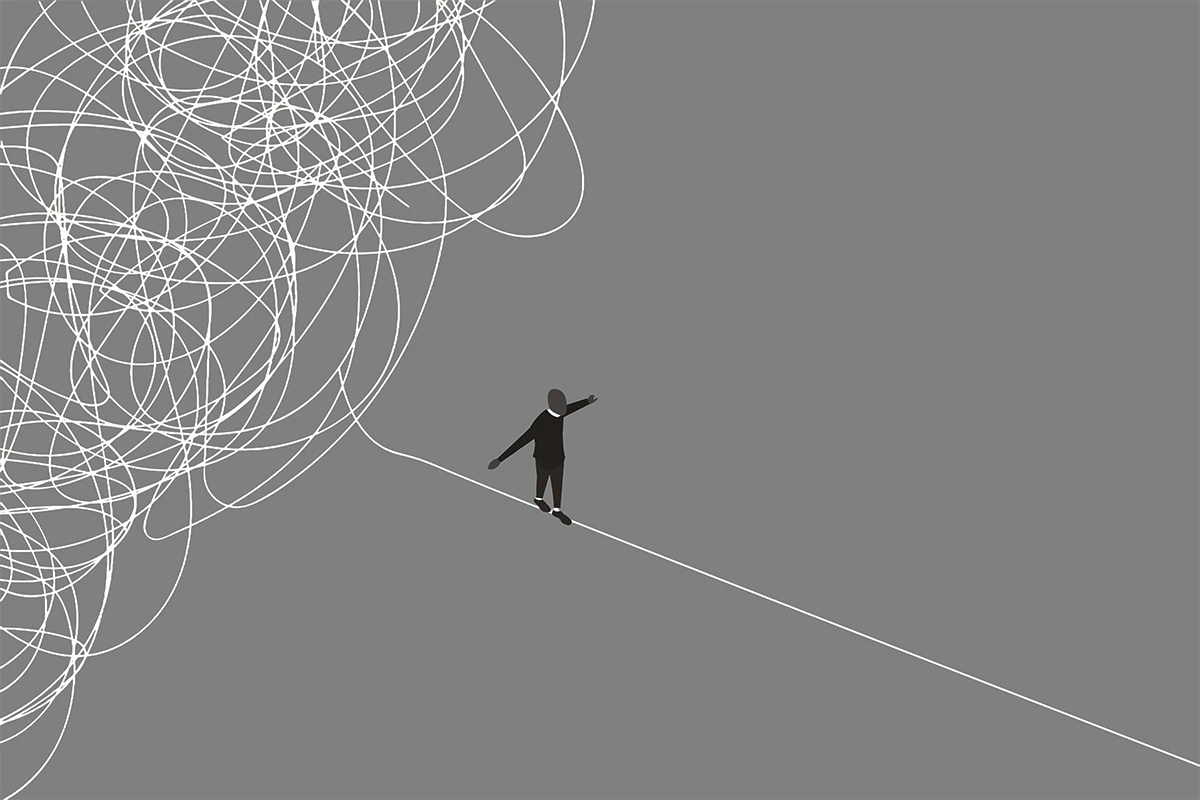Snowflake vs. Databricks



Von BI bis Machine Learning – welche Data Platform passt?
Wenn es um die Auswahl einer Datenplattform geht, begegnen uns immer wieder zwei große Namen: Snowflake und Databricks. Für welchen Anbieter sollen sich datengetriebene
Unternehmen entscheiden?
In der heutigen Datenlandschaft stehen Entscheider immer wieder vor der Herausforderung, aus einer Menge von erhältlichen Technologien die beste Wahl für ihr Team zu treffen. Nicht nur die Menge an Daten-Tools ist überwältigend, sondern auch die Aufgabe, genau das Produkt auszuwählen, dessen Eigenschaften am besten zu den Use Cases des Unternehmens passen.
Welche Data Platform ein Unternehmen wirklich weiterbringt, ist abhängig von seinen spezifischen Anforderungen. Deshalb machen wir es uns zur Aufgabe, gemeinsam mit Entscheidern und deren Data Team die spezifischen Interessen und Ziele der einzelnen Stakeholder zu analysieren, um sie mit dem besten Produkt zusammenzubringen. Unter den folgenden Gesichtspunkten analysieren wir dann die Frage: Snowflake oder Databricks? In diesem Artikel zeigen wir, welche Plattform unter welchen Bedingungen die beste Wahl ist – abhängig von Roadmap, Team-Skills, Implementierungszeit und Kosten.
Die Frage Snowflake vs. Databricks wäre vor ein paar Jahren noch einfacher zu beantworten gewesen. Snowflake hat als natives Cloud Data Warehouse begonnen, das vor allem durch die voneinander entkoppelte Speicherung und Compute Leistung punkten konnte. Dabei lag der Fokus noch stark auf SQL-Abfragen, deren Optimierung und die schnelle Beantwortung von analytischen Fragen. Databricks wurde für Machine Leaning und Data Science auf Apache Spark basierend entwickelt und verfolgt den Ansatz Data Lakehouse.
Doch beide Unternehmen haben ihre Data Platforms immens weiterentwickelt und wollen ihren Kunden eine holistische Lösung präsentieren. Databricks ist mittlerweile weit verbreitet als Data Warehousing Plattform, unterstützt auch SQL-Abfragen und entwickelt sich für klassisches BI weiter. Snowflake hat große Investitionen und Entwicklungen in Richtung AI/LLM getätigt und bezeichnet sich heute als AI Data Cloud. Beide Wettbewerber bieten immer ähnlichere Features und liefern sich im Marketing harte Gefechte.
Engineering im Data Team
Wenn wir als taod mit Kunden gemeinsam ein Data Warehouse konzeptionieren und aufbauen, besetzen wir die Engineering- und BI-Rolle meist nicht allein. Für gewöhnlich erarbeiten wir mit dem Data Team des Unternehmens, das bisher mit einem Legacy Data Warehouse gearbeitet hat, gemeinsam sämtliche Vor- und Nachteile der anvisierten Datenplattformen. Unser Ziel ist es, das bestmögliche Produkt zu empfehlen, mit dem alle Mitarbeiter dann effektiv weiterarbeiten können.
Wir stellen mit unseren Projekten etwas auf die Beine, das für viele Jahre produktiv genutzt und vom Kunden-Team weiterentwickelt werden kann. Gerade deswegen muss bei der Auswahl der Plattform auch auf die Fähigkeiten des Data Teams geachtet werden. Entscheidend ist die “Herkunft” der Engineers, die mit dem Programm arbeiten sollen: Ist deren Fokus die Entwicklung mit SQL oder Python gewesen?
Databricks basiert auf Apache Spark und kann deswegen auch am effektivsten mit PySpark genutzt werden. Snowflake, mit Wurzeln als Data Warehouse, ist gut für Personen mit SQL-Background geeignet. Die Einarbeitung wird hier schnell stattfinden können, vor allem, wenn Teammitglieder SQL-Profis aus klassischen On-Premise-Umgebungen stammen. Wenn es sich um einen Greenfield Approach handelt, ist aber zu berücksichtigen, dass SQL schnell zu erlernen ist, Snowflake schlecht geschriebene SQL-Abfragen auch noch optimiert und Teams mit verschiedenen Backgrounds dort gut zusammenarbeiten können.
Auch die generelle Affinität des Data Teams zu Aufgaben der DevOps-Rolle kann entscheidend sein. Snowflake ist einfach zu nutzen und zu verwalten, bietet aber weniger Granularität. Das bedeutet, dass viele Prozesse wie Skalierung, Performance-Optimierung und Clustering automatisch gesteuert werden, was den operativen Aufwand reduziert – aber auch weniger Kontrolle über einzelne Parameter ermöglicht. Im Gegensatz dazu benötigt Databricks mehr Aufmerksamkeit des Teams für die Kalibrierung einzelner Prozesse, bietet aber mehr Flexibilität für komplexe Workloads. Hier können spezifische Compute-Ressourcen, Speicherstrategien und Optimierungsmechanismen feiner abgestimmt werden, was besonders für datenintensive und leistungsrelevante Anwendungen wichtig sein kann.
Ein Team mit starkem SQL-Hintergrund kann Snowflake in wenigen Tagen produktiv nutzen, während Databricks ein initiales Setup für Cluster und Berechtigungen erfordert, das DevOps-Ressourcen bindet. Auch im laufenden Betrieb bleibt der Betreuungsaufwand unterschiedlich: Snowflake verfolgt einen „Zero-Maintenance-Ansatz“, bei dem Skalierung, Performance-Tuning und Infrastruktur-Management weitgehend automatisiert sind. Das reduziert den administrativen Overhead und macht die Plattform langfristig wartungsarm. Databricks hingegen bietet zwar mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten, erfordert aber auch eine kontinuierliche Optimierung von Clustern, Speicherstrategien und Berechtigungen, was langfristig mehr DevOps-Kapazitäten beanspruchen kann. Es kann daher hilfreich sein, die bereits vorhandenen Fähigkeiten des Data-Teams zu nutzen und es dadurch zu stärken. Das entlastet das Team bei den Aufgaben, die es sowieso schon hat.
Nutzung out of the box
Beim Thema Setup sind Snowflake und Databricks einem ganz anderen Tool gegenüberzustellen: dbt. Unserer Meinung nach profitiert jedes Projekt, das in Databricks oder Snowflake aufgebaut wird – in unterschiedlichen Punkten zwar, aber dennoch unverzichtbar – von dbt als Transformations-Tool.
Databricks erfordert zu Beginn die Unterstützung erfahrener DevOps-Mitarbeiter, um effektiv genutzt werden zu können. Ist das Setup jedoch abgeschlossen, erleichtert die Plattform die Organisation, Versionierung und Verkettung von Arbeitsschritten erheblich. Ein entscheidender Vorteil gegenüber Snowflake ist die Möglichkeit, Jobs
flexibel zu erstellen und auszuführen – ein wichtiger Aspekt für Data Teams, die keine zusätzlichen Tools nutzen möchten.
Es wird oft als „Lakehouse-Plattform“ beschrieben – also als Kombination aus Data Lake und Data Warehouse.
Allerdings fehlt Databricks eine eingebaute Test-Funktionalität, und Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen werden nicht automatisch erkannt. Der Erfolg eines Projekts hängt stark davon ab, dass Data Engineers alle Abhängigkeiten kennen, mit den relevanten Datenpunkten vertraut sind und bereits vor dem Einlesen eine hohe Datenqualität sichergestellt wird. Ohne erheblichen manuellen Aufwand lassen sich weder Datenqualitäts-Tests noch auf Abhängigkeiten abgestimmte Job-Abfolgen effizient konfigurieren. Besonders in der Anfangsphase kann dies dazu führen, dass ein Projekt länger als nötig in den Kinderschuhen steckt.
Die Snowflake UI ist übersichtlicher als die von Databricks und ermöglicht eine schnellere Einarbeitung. Zudem kann Snowflake in bestimmten Szenarien eine bessere Compute-Performance bieten und Daten von externen Quellen effizienter integrieren.
Ein entscheidender Faktor für den erfolgreichen Einstieg in ein Tool ist eine gut strukturierte und verständliche Dokumentation. Laut vielen Nutzern ist die Snowflake-Dokumentation besonders übersichtlich und leicht zugänglich. Um sich Wissen anzueignen, greifen Data Engineers oft auf Communities und Foren zurück, tauschen sich hier aus und bilden sich weiter. Sowohl Snowflake als auch Databricks verfügen über umfangreiche Ressourcen, aktive Diskussionsplattformen und offizielle Dokumentationen, die Entwickler und Architekten umfassend unterstützen.
Strategische Ausrichtung
Um nicht nur aktuelle Use Cases zu berücksichtigen, sondern auch zukünftige Anforderungen – etwa den Aufbau eines Data Warehouses, den beide Plattformen unterstützen – sollte die gesamte Unternehmens-Roadmap in die Entscheidung einfließen. Welche Aufgaben soll die Plattform langfristig übernehmen? Und welche Fragen sollen mit den vorhandenen Daten beantwortet werden?
Stehen vor allem Business Intelligence (BI) und analytische Workloads im Fokus, ist Snowflake die bessere Wahl. Wenn jedoch auch die Nutzung von Daten für Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) eine Rolle spielt, lohnt sich ein erneuter Vergleich beider Plattformen. Ein Data Scientist kann auf beiden Systemen bekannte Werkzeuge einsetzen, doch Databricks ist in diesem Bereich ausgereifter und verfügt über mehr Erfahrungswerte im Umgang mit ML- und AI-Workloads.
Snowflake allerdings punktet mit einem stärkeren Partner-Ökosystem. Es erleichtert die Integration externer Tools und die Nutzung von Drittanbieter-Lösungen, um Daten vielseitig weiterzuverarbeiten. Zudem unterstützt Snowflake Teams und Unternehmen, die wenig Erfahrung mit Data Science haben, indem es komplexe Sachverhalte einfacher zugänglich macht.
Kostenoptimierung und Preisstruktur
Beide Plattformen verfolgen ein Pay-as-you-go-Modell, das sich hauptsächlich auf die Compute-Kosten bezieht. Zusätzlich fallen Speicherkosten an: Bei Databricks entstehen diese durch den externen Storage beim gewählten Cloud-Anbieter, während Snowflake den Speicher intern verwaltet und direkt abrechnet.
Snowflake kann durch niedrige Einstiegskosten und einfach zu nutzende Kostenoptimierungstools wie Auto-Suspend für Compute-Cluster günstiger sein und bleiben. Databricks hingegen ist bei großen Datenmengen, insbesondere bei ML-Workflows, oft effizienter und kann dadurch unter bestimmten Bedingungen kostengünstiger sein.
Welches Tool tatsächlich günstiger ist, hängt jedoch stark vom individuellen Use Case ab. Snowflake überzeugt durch ein transparenteres Preismodell, da es automatisch Kostenoptimierungs- und Monitoring-Tools bereitstellt – ein Bereich, in dem Databricks noch hinterherhinkt. Durch die Kombination unterschiedlicher Features, variierende Preismodelle und cloudabhängige Abrechnungen kann es bei Databricks schwieriger sein, die tatsächlichen Kosten zu überblicken und zu optimieren. Allerdings lässt sich mit erfahrenen Databricks-Profis im Team das Kostenniveau gezielt steuern – etwa durch den Einsatz von Spot-Instances oder die dynamische Anpassung der Cluster-Größe.
Wie bereits erwähnt, kann es sowohl bei Snowflake als auch Databricks notwendig sein, Drittanbieter-Tools für BI, Datentransformation oder Data Governance zu nutzen – was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Snowflake punktet hier mit einem starken Partner-Ökosystem, macht aber den Einsatz solcher Tools oft erforderlich. Für Data Engineers ist beispielsweise die Nutzung eines Tools wie dbt nahezu unerlässlich, wenn die Wahl auf Snowflake fällt.
Sowohl Snowflake als auch Databricks sind teurer als traditionelle Datenbanken, wenn lediglich eine einfache Datenbanklösung gesucht wird. Soll jedoch eine ganzheitliche Datenplattform aufgebaut werden, kann die Entscheidung gegen ein modernes Tool langfristig teurer werden – nicht nur in direkten Kosten, sondern auch in verpassten Chancen und Insights. Unserer Meinung nach ist die Wahl für eines dieser Tools eine Investition in die Zukunft eines datengetriebenen Unternehmens – eine, die sich langfristig schnell auszahlen kann.
Conclusio
Snowflake oder Databricks? Die Antwort darauf ist hochgradig individuell und hängt davon ab, wie dein Unternehmen die oben genannten Fragen beantwortet und priorisiert. Ein wichtiger Aspekt sei am Ende noch erwähnt: Beide Plattformen lassen sich für die meisten Use Cases passend machen. Allerdings sollten die Skills deines Data-Teams eine entscheidende Rolle bei der Wahl spielen, sonst müssen Zeit und Geld in Weiterbildungen investiert werden. Wichtig ist auch: Eine Kombination aus beiden Tools bleibt immer eine Option.

Dieser Artikel erschien erstmalig in unserem Magazin data! Ausgabe 5. Jetzt kostenlos lesen.